
Thomas Meaney, Persona Grata – Sidecar
Henry Kissinger (1923-2023).
Persona Grata
Von Thomas Meaney
08. Dezember 2023
Der alte Bastard ist also endlich gestorben.
Consigliere von Jared Kushner, Vorstandsmitglied von Theranos, Mitautor des Google-CEO, Werber für Gold und The Economist im amerikanischen Fernsehen, Massenproduzent von selbstschmeichelnder Prosa, Headhunter für US-Besetzungen im Nahen Osten, glorifizierter Telefonist zwischen Washington und Peking: Die Industrie von Henry Kissingers endlosem Zwielicht war nur noch durch ihre Geschmacklosigkeit übertroffen. In dieser Hinsicht war er, wie in vielen anderen, ein unscheinbares Produkt seines Landes. Die Vorstellung, dass die Beihilfe zu Massakern von Ostpakistan bis Osttimor einen Quantensprung in den Annalen amerikanischer Gräueltaten darstellte, macht ihn für seine Apologeten wie für seine Kritiker zu einer fast zu bequemen Figur: Sie erhebt ihn in den (von ihm selbst lange angestrebten) Status des entscheidenden US-Außenpolitikers der Nachkriegszeit, während sie seinen flinkeren Verteidigern ein fast zu großzügiges Gebäude der Infamie bietet, an dem sie sich abarbeiten können. War es so unerwartet, dass das Land, das japanische Zivilisten in die Luft sprengte, um Tokio an den Verhandlungstisch zu bekommen, auch Kambodschaner in die Luft sprengte, um Hanoi an den Verhandlungstisch zu bekommen? War die Unterstützung des Massakers an den Timoresen eine ungewöhnliche Folge der Unterstützung des Massenmords an den indonesischen „Kommunisten“? War es so schockierend, dass die politische Klasse, die den Schah eingesetzt hatte, auch den Weg für Pinochet ebnete? War die Bilanz von Dr. Kissinger im Nahen Osten wirklich schlechter als die seines alten Erzfeindes Dr. Brzezinski? Um herauszufinden, was diesen Mann auszeichnete, muss man vielleicht woanders suchen.
Kissingers Karriere stand unter dem Vorzeichen, dass er einem Land, das in seine eigene Unschuld verliebt war und durch seinen eigenen Idealismus behindert wurde, geopolitische Notwendigkeiten vor Augen führte (mit dem Begriff „Realismus“ konnte er sich nie wirklich anfreunden). („Der amerikanische Idealismus … hatte sich mit seinen eigenen Waffen geschlagen“, heißt es in seinen Büchern und Memoiren immer wieder). Die Ironie des Ganzen war vielfältig. Die erste bestand darin, dass ein Land, das von hartgesottenen Staatsmännern von Teddy Roosevelt über Dean Acheson bis Richard Nixon geführt wurde, sich in irgendeiner Weise von zimperlichen Idealisten abhängig machte, die eine Dosis deutscher Realpolitik brauchten, als ob die herrschende Klasse Amerikas bei der Verfolgung ihrer Interessen nicht schon immer vollkommen rücksichtslos gewesen wäre. In der Tat wurde sie dafür im angeblich „realistischen“ Kernland weithin bewundert. Wir Deutschen schreiben dicke Bände über Realpolitik, verstehen sie aber nicht besser als Babys in einem Kinderzimmer“, erinnerte sich der Redakteur der New Republic, Walter Weyl, daran, wie ihm ein Berliner Professor während des Ersten Weltkriegs sagte. Ihr Amerikaner versteht sie viel zu gut, um darüber zu reden“. Als Deutscher, der sich über den amerikanischen Imperialismus äußert“, schwärmte Carl Schmitt, „kann ich mich nur wie ein Bettler in Lumpen fühlen, der über die Reichtümer und Schätze der Ausländer spricht. Wie Baudrillard einmal über die französische Theorie sagte, war die deutsche Realpolitik wie die Freiheitsstatue: ein Geschenk des alten Kontinents, das die Amerikaner weder wollten noch brauchten.
Die zweite Ironie besteht darin, dass Kissinger selbst nie wirklich ein „Realist“ war, zumindest nicht im Sinne eines John Mearsheimer oder eines Hans Morgenthau. Er glaubte von Anfang an, dass die USA nur mit einem maximalen Engagement für ihre eigene missionarische Ideologie triumphieren könnten. Eine kapitalistische Gesellschaft, oder, was für mich interessanter ist, eine freie Gesellschaft, ist ein revolutionäreres Phänomen als der Sozialismus des neunzehnten Jahrhunderts“, sagte Kissinger 1958. Ich denke, wir sollten in die geistige Offensive gehen“. Selbst wenn er als Realist auftrat, scheinen viele seiner Einschätzungen auf einer drastischen Überschätzung der kommunistischen Macht zu beruhen, die er in seiner Theorie der „Verknüpfung“ treffend zum Ausdruck brachte. Den Vietnamesen musste eine Lektion erteilt werden, damit Castro nicht auf dumme Gedanken kam. Pinochet musste installiert werden, um den italienischen Kommunisten Angst einzujagen. Es war ein Bild von der Welt, in dem jede Aktion mit einer anderen kurzgeschlossen war. Sogar sein gepriesenes Verständnis von China war voller bizarrer Einschätzungen, wie zum Beispiel, dass es sich für China durchaus gelohnt habe, dass Deng Xiaoping 40.000 Soldaten in seinem Abenteuer gegen Vietnam vergeudet habe, da es schließlich das Sowjetreich davon abgehalten habe, sich bis nach Phnom Penh und Bangkok auszudehnen.
Kissinger entdeckte früher als die meisten seiner Kollegen, dass Berühmtheit die ultimative Trumpfkarte im amerikanischen Leben ist. Sein Ansehen erlaubte es ihm gelegentlich, mit weniger Euphemismus zu sprechen als der Rest des Establishments. Anstatt die illegale Bombardierung Kambodschas einfach zu leugnen, erklärte Kissinger ganz kühl die Gründe für die Bombardierung als Vergeltung dafür, dass Hanoi das Land für seine Nachschubwege nutzte, und behauptete gleichzeitig, dass dies den Friedensprozess beschleunigt habe. Was Kissinger an der Diplomatie am meisten bewunderte, war der unerwartete Vorstoß. Sein Lieblingsspielzug in der Geschichte der europäischen Diplomatie waren vielleicht die Heiratsverhandlungen Bismarcks – den Kissinger weit mehr bewunderte als Metternich – um die Hand von Johanna von Puttkamer. Angesichts eines potenziellen pietistischen Schwiegervaters, der dem schneidigen jungen Mann nicht wohlgesonnen war, ergriff Bismarck Johanna vor ihrem Vater und küsste sie, womit er sie vor vollendete Tatsachen stellte.
Doch bei allen überraschenden Schachzügen, die Kissinger in seiner eigenen Karriere feiern sollte (die „Rochade“ in China und der Sowjetunion war Nixons Idee), fiel er eher durch seine absolute Konventionalität in praktisch allen außenpolitischen Fragen auf. Er trat nie in einem schiefen Winkel auf wie Kennan. Sein Markenzeichen war es, Hintergedanken für das zu finden, was der Staat bereits tat: Bosnien; der Irak-Krieg (auf der Grundlage von Saddam Husseins Verletzung der Flugverbotszone und nicht von Massenvernichtungswaffen); Anfang dieses Jahres befürwortete er in einer typischen Kehrtwendung sogar den Beitritt der Ukraine zur NATO. Im Gegenzug war er in jeder Regierung eine Persona grata. Er meldete sich regelmäßig bei mir, teilte mir scharfsinnige Beobachtungen über ausländische Staatsoberhäupter mit und schickte mir schriftliche Berichte über seine Reisen“, so Hillary Clinton über ihre Zeit als sein ehemaliger Außenminister. Ich spreche wahrscheinlich mehr mit Henry Kissinger als mit irgendjemand anderem“, sagte Dick Cheney auf dem Höhepunkt der zweiten Invasion im Irak. Wir sind schon seit langem befreundet“, sagte Präsident Trump und hielt sich dabei an das Drehbuch. Er ist ein Mann, vor dem ich großen, großen Respekt habe“. (In seltenem Kontrast dazu lesen sich Bidens Beileidsbekundungen an Kissingers Familie wie das Beltway-Englisch für „Verpiss dich“).
In der Galerie der Kalten Krieger hob sich Kissinger unter anderem durch seine Haltung gegenüber der Dritten Welt ab, die er als größere Bedrohung ansah als die Sowjetunion. Kissinger fühlte sich in der Rivalität der beiden Mächte sehr wohl – all die gemütlichen Mittagessen mit Dobrynin -, aber die Aussicht, dass die Länder des Südens ihren Ölreichtum nutzen würden, um sich zu modernisieren und die von den USA geführte Ordnung herauszufordern, war unerträglich. Daher die vielen Fotos, auf denen Kissinger mit Leuten wie Suharto und Mobutu verhandelt, und warum er sich die Mühe machte, mit Entkolonialisierungsexperten wie seinem alten Harvard-Kollegen Rupert Emerson in Kontakt zu bleiben. Mitte der 1970er Jahre begann Kissinger, öffentlich ideologische Arbeit zu leisten, um der Rhetorik der Neuen Internationalen Wirtschaftsordnung entgegenzuwirken, und privat logistische Arbeit zu leisten, um die Öleinnahmen der OPEC in die Wall Street statt in Entwicklungsprojekte zu lenken. Dies wurde als besser angesehen als die Suche nach einem Vorwand für militärische Maßnahmen gegen die OPEC-Staaten, die Nixon und Kissinger ebenfalls in Erwägung zogen.
Wie wurde Kissinger zu einem solch gierigen historiographischen Schwarzen Loch, das die Aufmerksamkeit von Historikern, Journalisten und Kritikern der US-Außenpolitik aus allen anderen Ecken auf sich zog und sie auf eine einzige Figur konzentrierte? Ein Grund dafür ist, dass Kissinger eines der ersten Produkte der meritokratischen Nachkriegsakademie war, das zu einer solchen Höhe aufgestiegen ist. Der bittere Stachel, den seine akademischen Kollegen empfanden, als einer der ihren eine solche Macht erlangte, machte ihn zum besonders negativen Objekt ihrer Faszination, getrieben von unverkennbarem Neid auf einen Mann, zu dessen wichtigsten Entscheidungen nicht mehr die Frage gehörte, ob er einem jungen Fakultätsmitglied eine Festanstellung gewähren sollte. Das Ergebnis war eine gegenseitige Wertschätzung, wobei die akademischen Historiker Kissinger aufwerteten und Kissinger sie im Gegenzug aufwertete (in den Tonbändern zwischen Nixon und Kissinger ist der Übergang von Gesprächen über vietnamesische Bombenziele zu Beschwerden über „die Professoren“ zu hören). Mit Niall Ferguson hat Kissinger geschickt einen Verteidiger gewählt, der ihm in jedem Punkt zur Seite steht (schon in seinem ersten Band hat Ferguson nicht zu Unrecht behauptet, dass der Inhalt von Kissingers Berichten an das Nixon-Team von den Pariser Friedensgesprächen für jeden aufmerksamen Zeitungsleser nachvollziehbar gewesen wäre).
Wichtiger als die Logik der Akademie war jedoch Kissingers Gespür für die Schwachstellen im amerikanischen Pressekorps. Er war ein Meister darin, den Journalisten zu schmeicheln oder sie zu langweilen, wenn es nötig war, und er war dort in seinem Element, wo andere am plattesten waren: im Stegreifinterview, im Sperrfeuer der Fragen auf dem Podium. In einem der Zeitfenster, in denen Intellektuelle in Amerika Berühmtheiten waren, und auf dem Rücken einer Kennedy-Administration, die voll von ihnen war, projizierte Kissinger ein riesiges Gehirn, das von komischem Timing durchdrungen war, Peter Sellars‘ Strangelove, der unheimlich und erfreulich lebendig wurde. Ein Köcher voller selbstironischer Sprüche stand bereit. Er war, wie er zu sagen pflegte, stets bemüht, „eine ausweichende Antwort zu organisieren“. In diesem Bereich hatte er mehr von Kennedy als von Nixon gelernt: Lass die Presse nie vergessen, dass du einer der ihren bist. Man kann das Klicken der Absprachen im Hintergrund hören, wenn er über seine Witze lacht. Bei der Begrüßung ausländischer Diplomaten keuchte er: „Ich habe nicht mehr vor einem so vornehmen Publikum gesessen, seit ich allein im Spiegelsaal von Versailles diniert habe“. Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis Kissinger in diesem Verhältnis gesehen wird: ein ungewöhnlich guter Schüler der Stimmungen und ein treuer Diener der Interessen der Elite seines Landes.
Lesen Sie weiter: Anders Stephanson, „Ein Monument für sich selbst“, NLR 86.
Übersetzt mit Deepl.com
--
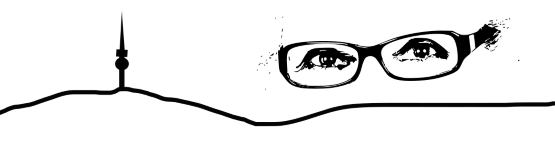





Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.