
Are we indeed all Palestinians?
Are we indeed ‚all Palestinians‘ as we chant on the streets of New York and London? If so, this rallying cry must abandon metaphor and manifest materially in resistance and refusal. Because Gaza cannot stand alone in sacrifice.
Bis zu 400.000 Pro-Palästina-Demonstranten gehen in Washington DC auf die Straße, um ihre Unterstützung für die Palästinenser zu zeigen und einen Waffenstillstand und ein Ende des Völkermords in Gaza zu fordern, 13. Januar 2024. (Foto: Eman Mohammed)
Sind wir wirklich „alle Palästinenser“, wie wir in den Straßen von New York und London skandieren? Wenn ja, dann muss dieser Ruf die Metapher verlassen und sich materiell in Widerstand und Verweigerung manifestieren. Denn Gaza kann nicht allein als Opfer dastehen.
Sind wir wirklich alle Palästinenser?
Von Mohammed El-Kurd
13. März 2024
Sie nahmen ihn am Flughafen fest, und das, so sagte mir mein Freund, war der „Silberstreif“. Er wusste, dass sie hinter ihm her waren, aber er hatte Angst, dass sie einbrechen und ihn aus seinem Schlafzimmer holen würden, was traumatischer ist als die Verhaftung während der routinemäßigen, wenn auch demütigenden Befragung, die man bei der Landung in Tel Aviv erwartet.
Omar wird für die nächsten vier Monate hinter Gittern in Verwaltungshaft sitzen. Eigentlich sollte ich schreiben „mindestens für die nächsten vier Monate“, denn die Haftanordnung kann auf unbestimmte Zeit verlängert werden, aber ich kann den Gedanken an diese herzzerreißende Möglichkeit nicht ertragen, ganz zu schweigen von dem, was sie ihm möglicherweise angetan haben oder noch antun.
„Es gibt nichts, was wir tun können“, sagten andere Freunde, als ich vorschlug, dass wir uns für seine Freilassung einsetzen sollten. Wenn man zu einem Verwaltungshäftling wird – der ohne Anklage oder Gerichtsverfahren als Geisel festgehalten wird – kann kein noch so großer öffentlicher Druck den militärischen Befehlshaber dazu bewegen, seine Entscheidung rückgängig zu machen. „Nicht einmal in Den Haag.“
Außerdem hätte er die Optik von Plakaten, Protesten und Posts in den sozialen Medien, die nur ihm gewidmet sind, verachtet, denn er hasst die unvermeidliche Individualität solcher Kampagnen. Was die Qualifikationen angeht, die notwendig sind, um ein westliches Publikum zur Solidarität zu verführen, so besaß er sie alle: die „einzigartige Geschichte“, den „respektablen Lebenslauf“, den „heiligen Charakter“.
Aber Hunderte in den zionistischen Kerkern erleiden das gleiche unbekannte Schicksal. Zehntausende, deren Leben – nicht nur die Freiheit – in den letzten Monaten dezimiert, pulverisiert wurde. Die meisten von ihnen sind namenlos, die meisten von ihnen sind unbesungen. Singuläre Geschichten, vor allem wenn sie rücksichtslos erzählt werden, neigen dazu, das Individuum von der Gruppe zu isolieren, die Ersteren zu heiligen und die Letzteren zu dämonisieren. Singuläre Geschichten neigen dazu, von Menschen verursachte Gräueltaten außerhalb der Politik zu verorten und sie als unerklärliche Naturkatastrophen neu zu erfinden.
Omar wurde gerade deshalb inhaftiert, weil er sich einer solchen Singularität verweigerte.
Da seine Anklagepunkte gemäß den Protokollen des Gefängnisses nicht veröffentlicht werden, kann ich nur vermuten, dass es seine entschlossene Präsenz auf der Straße, bei Protesten und bei der Unterstützung des Gefängnisses war, die ihn ins Blickfeld des Feindes brachte.
Als Ramallah schlief – oder betäubt war oder in politische Lähmung verfiel – gehörte er zu den wenigen Hundert, die in der schlafenden Stadt wach waren, die skandierten, schrien und verzweifelte Rauchzeichen sendeten, um Gaza zu sagen: „Ihr seid nicht allein“. Die verstümmelte Geografie unseres Landes konnte ihn (und die, die bei ihm waren) nicht vom Rest unseres Volkes trennen, seine Augen wachten über Gaza und hielten nur inne, um diejenigen anzustarren, die wegschauten.
Er hätte sich geweigert, von denen abzulenken, die von Tierfutter leben oder die Gliedmaßen ihrer Angehörigen an ihre gestohlenen Körper nähen; seine Verhaftung ist nur ein Symptom für einen viel bedrohlicheren Zustand. Auch das war ein Silberstreif am Horizont. Dies zu glauben, diese moralische und politische Klarheit zu verdauen, liegt leichter im Magen, als sich die eigene Ohnmacht oder, schlimmer noch, die eigene schäbige Rückgratlosigkeit einzugestehen.
Vor Jahren habe ich auf den Straßen von Ramallah, als die Stadt noch in Aufruhr war, einen morbiden Witz gemacht. Nizar Banat, ein Dissident, eine Art politischer Führer, war gerade von einer Spezialeinheit der Palästinensischen Autonomiebehörde ermordet worden (letztere hatte die israelische Erlaubnis erhalten, vom „Gebiet A“ in Ramallah zum „Gebiet C“ in Hebron, wo Banat wohnte, überzusetzen, um ihn zu ermorden) und Tausende protestierten.
„Erhebt, erhebt, erhebt eure Stimme“, skandierten wir, „wer skandiert, stirbt nicht!“ „Ironischerweise“, wandte ich mich an meinen Freund, „ist er gestorben, weil er gesungen hat.“ Ich weiß nicht, was ich mit Brutalität anfangen soll, außer darüber zu lachen. Mein Freund war nicht amüsiert.
Nizar ist gestorben, weil er allein war, schimpfte sie mich aus.
(In gewisser Weise war das eine vulgäre Anspielung auf Amal Dunquls Zeile „Ich hänge am Galgen des Morgens / und meine Stirn ist vom Tod gesenkt / denn lebendig habe ich sie nicht gesenkt.“ Dunqul schien zu glauben, dass der Henker nur diejenigen verschonen würde, die ihren Kopf in den Sand stecken.)
„Sie können uns nicht alle töten“, sagte sie. Wenn alle – Anwälte, Ärzte, Lebensmittelhändler, Geschäftsinhaber, Professoren, Hausmeister, Autohändler, Drogendealer – singen würden, so die Argumentation, könnte uns nichts töten, weder das Tränengas aus amerikanischer Produktion, das von den Sicherheitskräften der PA auf uns geworfen wird, noch die Kugeln, ebenfalls aus Amerika, die von Soldaten mit dem Davidstern auf ihren Uniformen auf uns abgefeuert werden.
Ob das wahr ist – dass „das geeinte Volk niemals besiegt werden wird“ – wird sich noch zeigen. Wahr ist, dass es bei unserem Rätsel nicht um Sieg oder Niederlage geht, sondern um die einfache Tatsache, dass es für uns keine Entschuldigung gibt, uns in unserem sicheren Schweigen zu verstecken, während unsere Geschwister abgeschlachtet werden.
Wie bitter, wie beschämend ist das Überleben, wenn es nur in der Einsamkeit gewonnen wird?
Sind wir wirklich alle Palästinenser, zu Tausenden und Millionen, wie wir in den Straßen von New York und London skandieren?
Ich habe mir diese Frage unaufhörlich und wie besessen gestellt. Noch vor zwei Jahren hätte ich gesagt, ja sogar erklärt, dass der Zement der israelischen Militärbarrieren nur ein Zement ist, der nur symbolische Bedeutung hat. Ihre kolonialen Grenzen, so sehr sie sich auch bemühen mögen, können und werden die sozialen und nationalen Bande, die unsere isolierten Städte zusammenhalten, nicht durchtrennen. Unsere unterschiedlichen Papiere – Reisedokumente, Pässe, Passierscheine oder deren Fehlen – sind nur Worte auf einer Seite, unfähig, uns zu trennen.
Diejenigen, die durch Belagerung oder Inhaftierung eingesperrt sind, so würde ich sagen, können sich immer noch im Geiste emanzipieren, und diejenigen, die hinter Mauern und Stacheldraht verstreut sind, können sich immer noch in ihren Herzen vereinen.
Und doch bin ich auf den Straßen von New York und London und protestiere – es gibt Repressionen, wenn auch noch kein Tränengas – und Omar sitzt in einer Zelle in einem der Gefängnisse der Besatzungsmacht (in denen seit dem 7. Oktober mindestens 35 palästinensische politische Gefangene den Märtyrertod erlitten haben). In Gaza werden Männer in Trainingsanzügen in die Brust oder in den Kopf geschossen, weil sie den Mut hatten, in eine gepanzerte Merkava zu rennen oder sich in relative Sicherheit zu bringen.
Im Flüchtlingslager Shatila in Beirut lebt und stirbt ein Großvater, der von Visionen seines alten Hauses am Strand verfolgt wird, die so greifbar sind, dass er sie fast riechen kann. In Jerusalem mache ich mir Sorgen um das Haus meiner Familie, um meinen Bruder auf dem Weg zur Arbeit, um die schießwütige Polizei.
Andere Städte könnten genauso gut andere Planeten sein, jede mit ihrer eigenen Haupttodesursache: Scharfschützen hier, Kriegsflugzeuge dort, Vertreibung, Exil, Auslöschung, Völkermord, Kindermord, Demütigung, Herzschmerz, Bürokratie, Inhaftierung, innergemeinschaftliche Gewalt, Diebstahl, Durst, Hungersnot, Armut, Isolation, Defätismus, Erpressung, was immer.
Die Zersplitterung ist nicht nur symbolisch, sie hat uns in eine Million Menschen verwandelt, die gleichzeitig in einer Million Staaten leben. Ein Teil unserer Gesellschaft, jedenfalls das, was von ihr übrig geblieben ist, hat in den letzten Jahren einen höheren und blutigeren Preis bezahlt als der Rest – ein Detail, das man nicht einfach übergehen kann.
Früher konnte ich mich leicht von den Klassen abgrenzen, die ich seit langem verachte und beneide (die Eliten, die Bourgeoisie und diejenigen, für die Palästina eine ästhetische Metapher ist), aber in dem engen Inferno des Gazastreifens ist eine neue Klasse entstanden: die Verhungerten und die wiederholt, unerbittlich und unerbittlich Enteigneten, und es ist unmöglich, mehr als ein ohnmächtiger Zuschauer zu sein, unmöglich, zu dieser Klasse zu gehören, nicht ohne blaue Flecken, nicht ohne Opfer.
Es ist verlockend, fast tröstlich – vor allem, wenn ich auf das Essen auf meinem Tisch und das Dach über meinem Kopf schaue -, in Schuldgefühlen zu schwelgen, aber es ist ein unproduktives Gefühl, es löst keine Revolutionen aus. Schuldgefühle drängen sich auf wie ein nörgelndes Loch, man ist sich ihrer Präsenz bewusst, aber man schaufelt sich immer wieder die gleichen Süßigkeiten in den Mund, bis die Zähne verfaulen, bis man sich selbst zerstört.
In diesen Tagen werde ich von einem subtileren, wenn auch tödlicheren Refrain heimgesucht, einer unerwünschten Erkenntnis: Gaza hat das Recht, uns im Stich zu lassen, uns niemals zu vergeben, uns ins Gesicht zu spucken. Wie viele Kriege hat es schon mitgemacht? Wie viele Märtyrer hat es gegeben? Wie viele Körper wurden ihm gestohlen, aus der Umarmung ihrer Väter gerissen? Und wie viele von uns stottern, wenn wir nach Widerstand gefragt werden, oder leugnen unser Recht auf Widerstand, unsere Notwendigkeit, Widerstand zu leisten? Wie viele von uns stellen ihre Karriere über ihre Familie? Wie viele von uns hätten etwas tun können, irgendetwas, haben es aber nicht getan?
Seit dem 7. Oktober haben viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, viele von ihnen Palästinenser, vor allem im Westen, die Katharsis, die sie beim Anblick der Bilder von „palästinensischen Bulldozern“, die Teile des israelischen Zauns um den Gazastreifen niederreißen, empfunden haben, überdacht oder sogar aufgegeben. Viele haben bereut, dass sie die Gleitschirmflieger gefeiert haben, die ihrem Konzentrationslager entkommen sind. (Ich habe „palästinensische Bulldozer“ in Anführungszeichen gesetzt, weil es eine unglaubliche Formulierung ist.)
„Es war [noch] nicht klar, dass Hunderte von ihnen absichtlich erschossen und entführt worden waren“, schrieb ein Künstler. Es ist schwer zu glauben, dass irgendjemand glaubte, die spektakulären Bilder des 7. Oktobers (das Einfangen von Militärpanzern und der anschließende Tanz auf ihnen) seien ohne Blutvergießen geschehen. Man beginnt sich zu fragen, ob diese versteckten Entschuldigungen kalkulierte Geschäftsmanöver waren.
Die westliche Welt mit ihren prominenten kulturellen und akademischen Einrichtungen lehnte den Aufstand in Gaza gegen die Belagerung ab und verlangte, dass unsere Intelligenz entsprechend handelt. Uns wurde befohlen, den Status quo aufrechtzuerhalten (einen Status quo, den viele von uns im Laufe ihrer Karriere diskursiv kritisiert haben), um unsere Positionen, unseren Zugang und unseren Ruf als die „Guten“ zu wahren.
Die Unterwerfung unter die koloniale Logik, die die Gewalt der Unterdrückten verunglimpft und vor der Gewalt des Unterdrückers die Augen verschließt, wurde zum Eintrittspreis. Einige zahlten ihn ohne zu zögern, andere taten sich schwer dabei.
Oder dieses Phänomen ist viel unschuldiger als gerissener Karrierismus; vielleicht haben wir einfach Angst. Die Angst ist überall um uns herum. Sie hat die Nachrichtenredaktionen und Universitäten befallen und ist in unsere Wohnungen und Gotteshäuser eingedrungen. Sie hat donnernde Erklärungen in anonymes Geflüster verwandelt. Diejenigen von uns, die sich auf die Seite der „Kinder der Finsternis“ stellen, werden erpresst und auf die schwarze Liste gesetzt. Entweder ihr seid auf unserer Seite oder auf der Seite der Terroristen“, sagen die Chefs und die führenden Politiker der Welt zu denen, die zuhören, und pflanzen Angst in ihre Herzen.
Handelt es sich bei diesen Ängsten um ein echtes psychologisches Leiden oder sind sie das Ergebnis einer erfolgreichen Politik der Angstmacherei, mit der die Massen unterdrückt werden sollen? Was ist das überhaupt für eine Angst, verglichen mit der Angst zu verhungern, von einem Militärpanzer überrollt zu werden, unter den Trümmern zu ersticken, der einzige Überlebende seiner Familie zu sein, sein Herz zum millionsten Mal brechen zu sehen?
Was ist diese Angst, wenn nicht Theater?
Auch ich habe Angst. Als ich die Nachricht von Omar hörte, sagten mir viele, ich solle nicht nach Hause zurückkehren, sonst würde ich auch in Handschellen sein. Aber selbst von meinem Glashaus aus kann ich mit Sicherheit sagen, dass es keinen Platz für Angst oder Schweigen gibt. Nicht, wenn wir gesehen haben, wie streunende Katzen unser Volk fressen, nicht, wenn wir gesehen haben, wie der Zionismus ihr Fleisch – das Fleisch unseres Volkes – immer wieder mit unerbittlicher, arroganter Straflosigkeit verbrennt.
Es ist fast so, als ob die Welt uns einen morbiden Witz erzählt: Wir werden euch töten, wenn ihr euch wehrt, und wir werden euch töten, wenn ihr euch versteckt, und wir werden euer Land verschlingen und eure Ozeane verschlingen und euch mit Hunger und Durst töten.
Die Massaker werden im Fernsehen übertragen und am helllichten Tag gesendet. Unsere Richter werden sie legalisieren. Unsere Politiker, träge, unfähig oder mitschuldig, werden sie finanzieren und dann Mitleid heucheln, wenn überhaupt. Unsere Wissenschaftler werden untätig bleiben, bis sich der Staub gelegt hat, dann werden sie Bücher darüber schreiben, was hätte sein sollen. Ihre verrotteten Institutionen werden uns nach unserem Tod ein Denkmal setzen.
Und die Geier, selbst aus unserer Mitte, werden durch Museen touren und verherrlichen, was sie einst verdammt haben, was sie nicht zu verteidigen wagten – unseren Widerstand -, ihn mystifizieren, entpolitisieren und kommerzialisieren. Die Aasgeier werden aus unserem Fleisch Skulpturen machen. Ein morbider Scherz, aber ich bin nicht amüsiert.
Wir befinden uns also in der letzten Stunde, falls es je eine gegeben hat. Die Aufgabe ist schwierig, oder schwer zu definieren. Und ich predige nicht von einer Kanzel, sondern spreche, während ich unter dem Gewicht meiner eigenen Hilflosigkeit ersticke und verzweifelt versuche zu verstehen, was ich tun soll.
Ich höre den Satz, dass wir unsere Märtyrer ehren müssen, aber wie sieht es aus, wenn wir sie wirklich ehren? Zeugnis ablegen, was auch immer das bedeuten mag, reicht nicht aus, zumindest nicht allein. Es reicht auch nicht aus, sie mit diskursiven Lobeshymnen und leeren, pseudoradikalen Slogans zu ehren.
Der Ruf, dass wir alle Palästinenser sind, muss sich von der Metapher lösen und materiell manifestieren. Das bedeutet, dass wir alle – ob Palästinenser oder nicht – den palästinensischen Zustand, den Zustand des Widerstands und der Verweigerung, in unserem Leben und in unserem Umgang mit anderen verkörpern müssen. Das bedeutet, dass wir unsere Mitschuld an diesem Blutvergießen und unsere Trägheit angesichts all dieses Blutes ablehnen. Denn Gaza kann nicht allein mit seinen Opfern dastehen.
Aber die Aufgabe ist schwierig. Können wir den Zionismus besiegen und seine monströse Herrschaft beenden? Sie ist sogar noch schwieriger zu definieren: Zersplitterung bedeutet, dass von uns an verschiedenen Orten unterschiedliche Dinge verlangt werden. Wir stehen vor unterschiedlichen Herausforderungen und Umständen. Können wir die Auswirkungen der Fragmentierung umkehren? Ein kollektiver Kampf scheint in einer hyper-kapitalistischen, hyper-survivalisierten Welt unmöglich. Die skrupellose Logik sagt uns, dass politische Disziplin eine unwirksame Waffe ist. Und persönliche Opfer (Kündigung des Arbeitsplatzes, Selbstverbrennung, Tausende von Dingen dazwischen) mögen sich sinnlos anfühlen, weil sie den Handelnden vernichten, während sie kaum eine Delle im Status quo hinterlassen.
Aber auch hier geht es nicht um ihren Status quo, sondern um unseren. Es geht um unsere Beziehung zu uns selbst und zu unseren Gemeinschaften. Die wenigen Momente des Nachdenkens vor dem Einschlafen, die kurze Begegnung mit dem Spiegel am Morgen, in denen wir uns fragen: Was sind die Vorwände, die uns von der Teilnahme an der Geschichte entbinden?
Wir sind hier, auf verschiedenen Planeten, in verschiedenen Realitäten. Aussagen, die ein „sollte“ oder „muss“ beinhalten, laufen Gefahr, abwertend und kurzsichtig zu sein. Dennoch kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass dieser folgenreiche Moment uns auffordert, die Grenze des Erlaubten anzuheben, und verlangt, dass wir unser Engagement für die Wahrheit erneuern, die Wahrheit auszuspucken, unerschrocken, unverblümt (und klug), egal in welchem Konferenzraum, egal wem ins Gesicht. Denn Gaza kann das Imperium nicht allein bekämpfen. Oder, um ein verbittertes Sprichwort zu verwenden, das meine Großmutter in den Abendnachrichten zu murmeln pflegte: „Sie fragten den Pharao: ‚Wer hat dich zum Pharao gemacht?‘ Er antwortete: ‚Niemand hat mich aufgehalten.'“
Übersetzt mit deepl.com
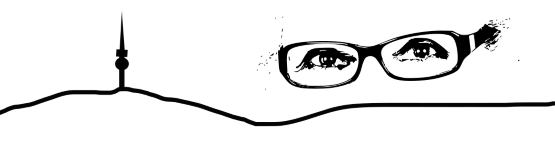





Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.