
What we’ve learned in New York City | Red Flag
Red Flag editor Ben Hillier has been in New York covering the student encampment movement in solidarity with Palestine. What has he learned?
Ein Polizist hält seinen Schlagstock in der Nähe des Fashion Institute of Technology, New York, 7. Mai FOTO: Ben Hillier
Was wir in New York City gelernt haben
Von Ben Hillier
12. Mai 2024
Der Redakteur von Red Flag, Ben Hillier, war in New York, um über die Bewegung der Studentenlager in Solidarität mit Palästina zu berichten und mit den Aktivisten zu sprechen – einige von ihnen sind neu, andere haben schon ein wenig Erfahrung, und auch einige der erfahrenen Veteranen in der Stadt. Hier reflektiert er über zwei Wochen voller Aktionen, Beobachtungen und Interviews und stellt die Frage: Was haben wir von New York City gelernt?
Es gibt Wochen, in denen Jahrzehnte vergehen“.
Die New Yorker Studenten, insbesondere die der Columbia University, haben eine moralische Klarheit geschaffen, die eine neue Bewegung in Gang gebracht hat. Als alles, was sie in ihrer Stadt antrafen, die Mitschuld an einem Völkermord oder dessen Akzeptanz war, stürzten sich die Studenten in die Gemeinschaftsräume ihrer Universitäten, um zu fordern, dass sich ihre Institutionen von Israel trennen.
Diese Aktivisten sind jedoch mit einem großen Aufgebot an Polizeikräften konfrontiert, die routinemäßig Menschen töten (in diesem Jahr bisher zehn, im letzten Jahr 34). Sie müssen ständig Verleumdungen über ihre Beweggründe und angebliche Bigotterie ertragen. Mehr als 500 Personen wurden in der ganzen Stadt verhaftet, und viele wurden von ihrem Studium suspendiert. Eine groß angelegte „Doxing“-Kampagne zionistischer Gruppen versucht, die künftigen Beschäftigungsaussichten der Aktivisten zu ruinieren. In New York steht also viel mehr auf dem Spiel als in Australien, wo die Studenten nicht mit so schweren Repressionen konfrontiert sind.
Im Laufe des israelischen Krieges und insbesondere seit dem Beginn der Lagerbewegung im April hat sich das politische Terrain hier schnell und dramatisch verändert. Zwei Aspekte sind besonders bemerkenswert.
Erstens ist das politische Bewusstsein der studentischen Aktivisten nach links geschwenkt. Ein offensichtlicher Grund dafür ist, dass das US-Establishment den Völkermord in Gaza bewaffnet, finanziert und unterstützt. Ein Teil davon hängt mit der Härte der Angriffe desselben Establishments auf die Studenten selbst zusammen – jede Institution der herrschenden Klasse in der Stadt hat sich gegen sie gestellt. Der wichtigste Grund ist jedoch die politische Färbung dieser Institutionen. Die Studierenden werden nicht von der MAGA-Crowd angegriffen, sondern von den Demokraten, die in New York alles kontrollieren und eine Welle von Polizeigewalt gegen die Camps angeordnet haben.
„Die Liberalen sind überall an der Macht – in der Bundesregierung, in der Legislative des Bundesstaates, beim Gouverneur, beim Bürgermeister, bei den College-Verwaltern“, sagt Michael Letwin, einer der Mitbegründer von Labor for Palestine, bei einem Kaffee in Brooklyn. Die Aktivisten machen keine „Phasen“ durch. Es ist eher so etwas wie eine ‚permanente Revolution‘ – sie springen über den alten liberalen progressiven Konsens hinweg und ziehen viel radikalere, sogar revolutionäre Schlussfolgerungen.“
In Gesprächen mit und Beobachtungen von Aktivisten in den letzten zwei Wochen gibt es dafür durchaus Belege. Zum Beispiel erzählte „S“ (viele Studenten wollen aus Angst vor Repressalien ihre richtigen Namen nicht nennen), ein junger jüdischer Student an der New York University, dass er sich zunächst über die Demokraten politisch engagierte, indem er bei der Wahlwerbung für progressive Kandidaten half. Aber nach Gaza und der Lagerbewegung ist es damit vorbei.
„Ich glaube, sie [die Demokraten] haben uns verloren. Man kann nicht fortschrittlich sein und Völkermord unterstützen“, sagte er. „Und es geht nicht nur um die Stimmen. Die Demokraten haben sich auf uns [junge Leute] als freiwillige Helfer verlassen – bei der Wahlwerbung, beim Klopfen an Türen, beim Verteilen von Material. Nach dem, was sie getan haben, machen wir das nicht mehr freiwillig. Wer würde sich freiwillig für einen Völkermord melden? Wer würde den Leuten helfen, die uns als Antisemiten angegriffen, die Polizisten gegen uns unterstützt und uns vom Campus suspendiert haben?“
Die Aussage von S. macht deutlich, dass es nicht nur einen Bruch mit der vorherrschenden institutionellen Form des etablierten Liberalismus (der Demokratischen Partei) gibt. Es gibt auch einen Bruch mit dem Zionismus, der seit mehr als einem halben Jahrhundert im Mittelpunkt der liberalen Ideologie in den Vereinigten Staaten steht. Die Sprechchöre auf den Kundgebungen und Zeltlagern spiegeln dies wider. Sie sind nicht nur kritisch gegenüber der israelischen Politik. Die meisten von ihnen stellen die Existenz des zionistischen Staates in Frage: „Israel muss fallen!“, „Keine Zionisten hier!“, „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein!“, „Eine Lösung: Intifada, Revolution!“
Ein zweiter Aspekt betrifft das Leben außerhalb des Campus: Die allgemeine politische Topographie hat sich verändert, zum Teil aufgrund des Radikalismus der Studenten. „‚Progressiv, außer für Palästina‘. Das war die Realität des Liberalismus hier“, sagt Letwin. „Gute Liberale unterstützen alle progressiven Anliegen und Bewegungen – mit Ausnahme der Sache Palästinas.“
Diese Realität habe zunehmend Risse bekommen. Aber die „Ausnahme Palästina“ ist jetzt zerbrochen, und es hat sich ein Riss im Gebäude des Liberalismus aufgetan, sagt Letwin. Nicht im Establishment. Und auch nicht in der Gewerkschaftsbürokratie, die nach wie vor fest zionistisch eingestellt ist, sagt er. Aber die kompromisslose Reaktion der Studenten auf die Repression, der sie ausgesetzt waren, hat in breiteren fortschrittlichen Kreisen, auch in Teilen der Gewerkschaftsbewegung, in der Letwin ein langjähriges Mitglied und Aktivist ist, zu einer noch nie dagewesenen Abrechnung geführt.
Während in den USA in letzter Zeit eine zunehmende Polarisierung zwischen Liberalen und Konservativen zu beobachten ist, gibt es nun auch eine Polarisierung innerhalb des Liberalismus. Sie zeigte sich in der Black-Lives-Matter-Bewegung von 2014 und in der Präsidentschaftskampagne des Senators von Vermont, Bernie Sanders (insbesondere in seiner Vorwahlkampagne gegen Hillary Clinton). Doch die aktuelle Polarisierung ist noch bedeutender, denn sie hat sich um das Unverhandelbare der imperialen Politik der USA entwickelt – die Unterstützung Israels. Innerhalb des Liberalismus und der Demokraten zeichnet sich in dieser Frage ein Krieg ab.
Abgesehen von den Spekulationen darüber, wie es weitergehen wird, lässt sich aus dem, was bereits geschehen ist, eine relevante Lehre ziehen. Vorsichtigere Aktivisten innerhalb progressiver Bewegungen versuchen immer, sie in eine konservativere Richtung zu lenken. Sie sagen, dass man, um effektiv zu sein, „die Mitte erreichen“, über das „Predigen an die Bekehrten“ hinausgehen und die Herzen und Köpfe gewinnen muss, indem man „respektvoll“ ist (was oft bedeutet, das Unerträgliche zu tolerieren). Auf diese Weise wird ein echter und dauerhafter Wandel herbeigeführt, so heißt es im Drehbuch.
Was wir in New York erlebt haben, widerspricht dieser Logik: Das politische Rad wurde nicht einfach durch moralische Klarheit gedreht, sondern durch die kompromisslose Rhetorik und das Engagement der radikalen Studenten für direkte Aktionen. Der Wandel vollzieht sich nicht immer auf diese Weise. Aber wenn er stattfindet, definiert er Generationen und verändert, was zuvor als unabänderlich galt.
Die „Elite“ der Studenten ist wichtig
Das brutale Vorgehen und die Verleumdungskampagne der liberalen Behörden der Stadt lassen sich nicht nur mit ihrer Intoleranz gegenüber israelkritischen Äußerungen erklären. Sie hat auch mit den Räumen zu tun, in denen der Antizionismus gedeiht.
Das liberale Establishment der herrschenden Klasse reproduziert sich selbst durch die Ivy League – erstklassige Colleges wie die Columbia University hier in New York City. Diese Einrichtungen sind Nutznießer enormer Zuwendungen, nicht damit sie intelligentere und effektivere Grundschullehrer, Sozialarbeiter oder Künstler hervorbringen. Sie sind überdotiert und „elitär“, weil sie Menschen ausbilden, die den US-Kapitalismus und insbesondere den US-Staat führen sollen. Überwiegend sind es die Studenten der Eliteuniversitäten, die in die Justiz, die großen Medienkonzerne, das diplomatische Korps, das Außenministerium, den Senat, die Exekutive und so weiter aufsteigen.
Dass die Ivy League zu einer zentralen Brutstätte für Antizionismus und Antiimperialismus geworden zu sein scheint, ist für die herrschende Klasse hier mehr als unerträglich. Bei allem abschätzigen Gerede in der Presse und unter Politikern über die jugendlichen Wutausbrüche „privilegierter College-Kinder“ sind die Aufmärsche doch gerade deshalb nicht von der Hand zu weisen, weil es sich um Söhne und Töchter des Establishments handelt.
In gewisser Weise sollte es nicht überraschen, dass das Lager des Fashion Institute of Technology als letztes mit Repressionen konfrontiert wurde und dass es im Großen und Ganzen in Ruhe gelassen wurde und nicht denselben öffentlichen Verleumdungen ausgesetzt war. Was werden die FIT-Studenten aus der Sicht des liberalen Establishments tun? Einen Palästina-Solidaritätsschal stricken? Ein paar digitale Kunstwerke schaffen? Der Einsatz an dieser Hochschule war nicht besonders hoch.
Nicht so an der Columbia. Von ihren Studenten wird erwartet, dass sie eine zentrale Rolle bei der ideologischen und institutionellen Reproduktion des US-Liberalismus spielen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Dopingkampagne besonders heftig und die Medienkampagne so zentral gegen sie und andere an den Eliteuniversitäten gerichtet war.
Die Studenten sind stärker als ihr Gewicht
„Eine organisierte Linke, derzeit unter dem Deckmantel der palästinensischen Flagge, versucht, liberale Universitäten und Städte zu übernehmen und letztlich zu ruinieren“, so Daniel Henninger, ein Kolumnist des Wall Street Journal, kürzlich.
In Wirklichkeit sind die militanten Studenten, obwohl sie aufrütteln, relativ wenige. In New York City gab es vielleicht 1.000 Aktivisten, die sich auf fünf Einrichtungen verteilten (die inzwischen alle geräumt sind), plus andere, die sich in einer Gesamtzahl von mehreren Tausend mobilisiert haben. Im ganzen Land sieht es ähnlich aus. Es ist nicht wie 1970, als in den Vereinigten Staaten mehr als 1 Million Studenten von fast 900 Universitäten an Arbeitsniederlegungen, Protesten und Besetzungen beteiligt waren.
Außerdem hat die organisierte Linke sowohl in New York als auch in den USA bei weitem nicht mehr das Gewicht, das sie Ende der 60er Jahre hatte, als allein die Black Panthers (eine von vielen organisierten revolutionären Gruppen) Tausende von Mitgliedern und eine Zeitung mit einer wöchentlichen Auflage von vielleicht 300.000 hatten.
Es gibt definitiv eine Radikalisierung bei einer Minderheit, die nach links ausbricht oder ausgebrochen ist. Aber die Tiefe und Breite der Politisierung ist nicht ganz klar. Für wie viele ist der Antizionismus ein revolutionärer Bruch mit dem Progressivismus und nicht etwa ein progressiver Bruch mit dem reaktionären US-Liberalismus, zum Beispiel? Es gibt ein gemischtes Bewusstsein, wie immer. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist ein klarer revolutionärer Pol in der Bewegung nicht erkennbar.
Das ist nicht überraschend. Die letzte große studentische Radikalisierung, die die Bürgerrechts- und die Anti-Vietnamkriegsbewegung miteinander verband, war das Ergebnis tiefgreifender sozialer Krisen. Die Bürgerrechtsbewegung stellte nicht eine bestimmte Regierungspolitik, sondern die gesamte diskriminierende Struktur der amerikanischen Gesellschaft in Frage. Vietnam wurde durch die Einberufung und die Entsendung von Millionen von Soldaten nach Indochina, von denen fast 60.000 in Leichensäcken und Hunderttausende mit Behinderungen zurückkehrten, zu einer sozialen Krise.
Heute gibt es keinen offensichtlichen Transmissionsriemen, durch den Palästina zu einer akuten sozialen Krise in den USA wird oder mit ihr verbunden ist. Dass die Studenten heute eine solche Wirkung auf die Politik haben, ist angesichts dieses Fehlens recht bemerkenswert. Michael Letwin weist – wahrscheinlich zu Recht – darauf hin, dass sich in den letzten Jahrzehnten in den USA eine Reihe anderer Krisen angesammelt haben, die nicht als Ursachen für politische Instabilität außer Acht gelassen werden sollten und die einen aufkommenden Radikalismus unterstützen könnten.
Charles Post, Mitglied des Tempest Collective und langjähriger Sozialist und akademischer Gewerkschaftsaktivist, sagt etwas Ähnliches:
„Es gibt einen kleinen, aber bedeutenden Aufschwung in breiteren sozialen Kämpfen, der berücksichtigt werden muss – die Zunahme von Streiks und gewerkschaftlicher Organisierung, die in den letzten Jahren oft von jungen Menschen angeführt wurde. Wenn sie in Gang kommen, könnten sie zu einer Art Anker für eine allgemeine Radikalisierung werden, wie es der Kampf der Schwarzen in den 1960er Jahren war. Natürlich gibt es viele Gründe, um vorsichtig zu sein, was die Aussichten auf einen starken Anstieg der Kämpfe am Arbeitsplatz angeht, insbesondere die unglaubliche Schwäche der organisierten Linken.“
Auf jeden Fall sind den Möglichkeiten der Studierenden zum jetzigen Zeitpunkt Grenzen gesetzt. Zwar haben einige wenige Universitätsverwaltungen um Frieden mit den Aktivisten, die die Camps betreiben, geklagt, aber die Bewegung hat bisher in erster Linie ideologische und nicht „materielle“ Auswirkungen. Dennoch sollte diese Leistung nicht heruntergespielt werden: Die Studenten haben etwas in Frage gestellt, das in der US-Politik bisher unumstritten war. Und sie haben möglicherweise das Bewusstsein einer ganzen Generation verändert. Das wird sich auf künftige Politisierungen und den gesamten Aktivismus auswirken.
Es könnte auch der Anfang von etwas viel Größerem sein. Es sollte zum Beispiel beachtet werden, dass die explosiven Jahre 1968-70 nach Jahren sozialer Kämpfe kamen, die zunächst nicht so spektakulär waren und in denen die Aktivisten ziemlich isoliert waren. So erzählte Noam Chomsky, ein prominenter Dissident, der sich seit 1961 gegen den Vietnamkrieg engagierte, 2015 eine Anekdote:
„Noch im Oktober 1965 … versuchten wir, an [dem ersten nationalen Aktionstag gegen den Krieg] in Boston, einer sehr liberalen Stadt, teilzunehmen … Der Marsch fand statt, wir kamen auf dem Common an, ich sollte einer der Redner sein, aber die Versammlung wurde von Gegendemonstranten völlig aufgelöst … Am nächsten Tag prangerte die liberale Zeitung Boston Globe, vielleicht die liberalste Zeitung des Landes, auf der Titelseite die Demonstranten an, die es gewagt hatten, leichte Kritik an den US-Bombardements in Nordvietnam zu üben.“
Die jüdische Kluft wächst
New York hat die größte jüdische Bevölkerung aller Städte der Welt. Und fast die Hälfte davon lebt in Brooklyn. In einem kleinen Café in der Nähe des Prospect Park erklärt Charles Post, der auch Herausgeber von Spectre: A Marxist Journal, erklärt die Spaltung dieser Gemeinschaft in der Israel-Frage, über die nur selten berichtet wird.
„Es ist ein Generationswechsel und ein noch nie dagewesenes Phänomen“, sagt er. „Seit 1967 hat der jüdische Antizionismus langsam und stetig zugenommen, wobei er in der Minderheit ist. Aber die Ereignisse der letzten sieben Monate haben die Dinge wirklich aufbrechen lassen.“
Interessanterweise ist das erste, worauf er hinweist, eher ein sozialer als ein politischer Wandel: eine größere Anzahl von Juden, die Nicht-Juden heiraten. In einer umfassenden Studie über das jüdische Leben in den USA, die 2021 vom Pew Research Center veröffentlicht wurde, wurde beispielsweise festgestellt, dass vor 1980 nur 18 Prozent der Juden einen nicht-jüdischen Ehepartner hatten. Diese Zahl stieg in den 1990er Jahren auf 37 Prozent, in den 2000er Jahren auf 45 Prozent und in den 2010er Jahren auf 61 Prozent.
„Eines der Ergebnisse [dieser Entwicklung] ist, dass anteilig weniger Kinder in die hebräische Schule geschickt werden. Dort findet die intensive zionistische Indoktrination statt. Das ist mir passiert – es wird einem einfach eingetrichtert, dass wir allein auf der Welt sind, dass alle hinter uns her sind, dass Israel großartig ist und von Leuten umgeben ist, die Juden töten wollen.“
Er schildert die faszinierenden Veränderungen der jüdischen Gesellschaft New Yorks seit dem Zweiten Weltkrieg. Im Mittelpunkt von Posts Ausführungen stehen jedoch die politischen Ereignisse, die die Gesellschaft verändert haben. Die erste Intifada (1987-93), die einige der liberalen zionistischen Mythen darüber erschütterte, wer in Palästina unterdrückt wurde und wer Unterdrücker war. Die wiederholten Angriffe auf Gaza, die jeweils zu einer zunehmenden Polarisierung zwischen Zionisten und Antizionisten in der jüdischen Gemeinschaft beitrugen. Der Zusammenbruch des Arbeiterzionismus und damit die Illusion eines sozialdemokratischen Israel. Der zunehmend illiberale Charakter der israelischen Regierung und Gesellschaft, der es jüngeren New Yorker Juden immer schwerer macht, die Quadratur des Kreises zwischen ihrem eigenen Liberalismus und den politischen Realitäten des Staates, den sie eigentlich unterstützen sollten, zu finden.
Das Gleichgewicht der Kräfte zwischen Antizionisten und Zionisten in der jüdischen Gemeinschaft ist nicht ganz klar. Die Pew-Umfrage aus dem Jahr 2020 ergab, dass acht von zehn US-Juden der Meinung sind, dass „die Sorge um Israel ein wichtiger oder wesentlicher Bestandteil des Jüdischseins ist“.
Wie sehr haben sich die Dinge nun verändert? In einem Artikel in der New York Times vom März stellte der Herausgeber der Jewish Currents, Peter Beinart, einen „sich abzeichnenden Bruch zwischen dem amerikanischen Liberalismus und dem amerikanischen Zionismus“ fest, der seiner Meinung nach „die größte Veränderung in der amerikanisch-jüdischen Politik seit einem halben Jahrhundert darstellt“. Unabhängig vom Ausmaß dieses Bruchs im Jahr 2024 wird er hier in New York, einem liberalen Kernland, in dem die jüdische Bevölkerung fest in der Hand der Demokraten ist, am deutlichsten zu spüren sein.
S, der oben zitierte junge jüdische Student an der New York University, ist hier zumindest ein Bezugspunkt. Wie viele seiner jüdischen Freunde sind Zionisten und wie viele sind Antizionisten oder vielleicht Nicht-Zionisten? „Mir fällt kein einziger engagierter Zionist ein“, sagte er nach einer Pause.
Eine weitere Entwicklung ist erwähnenswert, die sich auch auf die Politik der Demokraten auswirkt und die politische Sensibilität vieler jüdischer Liberaler in Frage stellt. „Dies ist das erste Mal, dass es eine palästinensische/muslimische/arabische politische Explosion in der US-Politik gibt“, sagt Joel Geier, ein Sozialist seit den 1950er Jahren. „Zum ersten Mal ist eine selbstbewusste palästinensisch-amerikanische Bewegung entstanden. Ihr Zentrum liegt nicht in New York, sondern in Michigan. Und Michigan ist für die Demokraten sehr wichtig. Es ist unmöglich, die Präsidentschaft zu behalten, wenn sie Michigan nicht gewinnen können.“
NYPD zeigt die Grenzen der Identitätspolitik auf
Was die Polizei angeht, so war die häufigste Beobachtung bei der Räumung der Lager, wie gewalttätig sie war (und wie die Gewalt die Bewegung nur vertieft hat). Aber es gibt noch eine andere politische Beobachtung. Nimmt man die Rasse als grundlegenden Rahmen für die Politik, wäre es fast unmöglich, die Gewalt in New York City zu verstehen.
Das Auffälligste an der NYPD ist, wie gemischtrassig sie ist. Den Statistiken der Stadt zufolge sind fast 57 Prozent der Streifenpolizisten und 48 Prozent der Lieutenants und Sergeants Schwarze, Latinos oder Asiaten. Bei den meisten Demonstrationen und Zeltlagern sahen sich die studentischen Aktivisten mit einer Wand aus schwarzen und braunen Polizisten konfrontiert, von denen immer mehr Frauen sind und deren Polizeichef ein Latino ist, der einem schwarzen Bürgermeister, Eric Adams, untersteht.
Diese Realität muss das politische Bewusstsein der Aktivisten in irgendeiner Weise beeinflussen. In den 1960er Jahren waren Polizisten fast ausnahmslos weiße Männer, was sektionalen Ideen, die mit verschiedenen Formen der Identitätspolitik verbunden waren, Legitimität verlieh und dazu beitrug, das Vertrauen in die Möglichkeit zu untergraben, dass Menschen sich über soziale Unterschiede hinweg vereinigen könnten.
Während die herrschende Klasse die Identitätspolitik eindeutig zu ihrem Vorteil genutzt hat, zeigt sie auch, dass Menschen nicht einfach durch ihren ethnischen Hintergrund, ihre Hautfarbe, ihr Geschlecht oder was auch immer definiert werden können – dass ihre politische und soziale Rolle oder ihre Klassenposition im System letztlich entscheidend ist. Die Existenz einer „intersektionalen“ Polizei hat das Potenzial, die Art und Weise zu verändern, wie Menschen sich gegenseitig sehen, insbesondere und vor allem diejenigen, die versuchen, Bewegungen zur Veränderung der Welt aufzubauen.
Nach Columbia
Das Studienjahr neigt sich an den meisten Universitäten dem Ende zu. Die Studentenwohnheime werden bald leer sein; die meisten werden für den Sommer nach Hause zurückkehren. Doch der Angriff auf Rafah hat gerade erst begonnen. Wird es ein spätes Frühlingsfeuer oder einen brennenden Sommer der Proteste geben? Wird sich die engagierte Minderheit an kleineren direkten Aktionen beteiligen, die sich jetzt vielleicht gegen Regierungsgebäude, Waffenfirmen oder Politiker richten? Wird das meiste davon vorbei sein, wenn der Unterricht im August wieder aufgenommen wird? Werden die suspendierten Aktivisten überhaupt wieder auf den Campus kommen? Was ist mit dem Parteitag der Demokraten in Chicago – wird es dort Szenen geben, die an das letzte Mal erinnern, als er in dieser Stadt stattfand?
Wer weiß das schon. Aber nach Columbia wird die Politik hier nie wieder dieselbe sein.
Übersetzt mit deepl.com
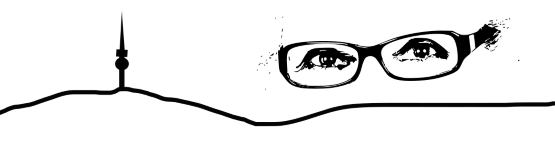





Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.