
Will man die Geschichte Europas verstehen, kommt man ISLAMOPHOBIA von Maria Elvira Roca Bareas Buch nicht vorbei. Es ist dem Westendverlag zu verdanekn, dass dieses fulminante Buch in Deutsch publiziert wurde. Es ist ein Gewinn, gerade in Zeiten der Russophobie und zeigt wie Geschichtsschreibung und Machtpolitik miteinander verwoben sind. Es lohnt sich die Mühe zu machen und dieses nicht einfach zu lesende Geschichtswerk zu lesen.
Evelyn Hecht-Galinski
https://www.nachdenkseiten.de/?p=83368

-
Woher kommt die Angst vor Imperien?
María Elvira Roca Barea zeigt in ihrem Buch „Imperiophobie“, dass die Angst vor dem Imperium über die Jahrhunderte hinweg auch von interessierter Seite geschürt wurde. Vom alten Rom über das russische Zarenreich bis hin zu den Vereinigten Staaten mussten das alle Weltreiche erfahren. Im Falle Spaniens wurde gezielt eine „schwarze Legende“ als Propagandamittel eingesetzt, um konträre Machtinteressen zu fördern. Roca Barea entlarvt historische Fehlannahmen und zeigt die enge Verquickung von Machtpolitik und Geschichtsschreibung. Der Aufbau der europäischen Einheit scheitert nicht zuletzt an tief verwurzelten Vorurteilen unter den Europäern, vor allem unter den Nordeuropäern gegenüber denen des Südens. Und sie sagt: Eine Neubewertung der europäischen Geschichte und die Überwindung der Vorurteile kann das Fundament einer stärkeren und gerechteren Union sein.
Ich begann im Jahr nach der Zerstörung der Twin Towers während eines Aufenthalts in den Vereinigten Staaten, mich mit der allgemein verbreiteten schlechten Meinung über Imperien zu beschäftigen. Es war das Ergebnis mehrerer Gespräche mit Amerikanern, die mir beharrlich erklärten, dass diese Anschläge eine verständliche, wenn nicht gar verdiente Strafe für die Übermacht der Vereinigten Staaten und deren außenpolitischen Fehlern seien. Ich habe vergeblich versucht, sie zum Nachdenken über die positiven Aspekte von Imperien zu bewegen, die es auch gab, und vor allem über das Engagement der USA für die Verteidigung der Demokratie in Westeuropa im 20. Jahrhundert, das der deutschsprachigen Leserschaft nur allzu gut bekannt ist. Dies ist eine Realität, der sich alle Europäer bewusst sein sollten, denn ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg würde es die Europäische Union heute nicht geben.
Meine Argumente, die ich in Gesprächen mit meinen Freunden in Boston vorbrachte, waren nicht besonders überzeugend, und ich konnte sie nicht dafür gewinnen, dass sie die Schwarze Legende Amerikas hinterfragen; sie hatten sie weitgehend übernommen. Genau in jenem Winter 2003 las ich Philip Wayne Powells „Tree of Hate“, ein grundlegendes Werk über die Schwarze Legende Spaniens. Damals erinnerte ich mich an meine Gespräche mit Pedro Arroyal Espigares, Professor für Paläographie und ausgezeichneter Kenner der Klassiker, des Römischen Reichs und der Gründe, warum eben jenes in so einem schlechtem Ruf steht, obwohl zweifelsohne unsere Zivilisation ohne Rom nicht vorstellbar ist. Das zeigt sich sogar bei Theodor Mommsen, dessen „Römische Geschichte“ jahrzehntelang die kanonische Sicht auf die römische Geschichte prägte. Band IV seines Werkes ist möglicherweise nicht geschrieben worden, weil er das Kaiserreich ablehnte.
War dieses Buch notwendig? Die Erforschung der Imperien ist so sehr von der Imperiophobie geprägt, dass jeder differenzierter Beitrag nützlich ist. Herfried Münkler, Professor für politische Theorie an der Humboldt-Universität zu Berlin, bedauert in seinem Buch „Imperien. Die Logik der Weltherrschaft. Vom Alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten“ (2005) diesen Mangel an Studien. Auf die Frage, was ein Imperium ist, erklärt er: »Womöglich ließe sich leichter eine Antwort darauf finden, wenn es in den vergangenen Jahrzehnten eine sozialwissenschaftlich ausgerichtete Imperiumsforschung gegeben hätte, die verlässliche Kriterien für Imperialität entwickelt hätte. Das ist jedoch nicht der Fall. Zwar sind eine unüberschaubare Fülle historiographischer Darstellungen zu einzelnen Imperien sowie bemerkenswerte komparative Arbeiten zum Imperialismus entstanden, aber die Frage, was ein Imperium ist und worin es sich von der in Europa ausgebildeten politischen Ordnung des Territorialstaates unterscheidet, ist so gut wie unbearbeitet geblieben.«
Münkler ist sich der moralischen Voreingenommenheit gegenüber über Imperien durchaus bewusst, und in diesem Punkt stimme ich ihm vollkommen zu. Er kommt zu dem Schluss, dass man in zwei Tagen nicht das aufholen kann, was bei der Grundlagenforschung jahrelang versäumt wurde.
Dies gilt für die Weltgeschichte und insbesondere für die Geschichte Europas, deren Entwicklung ohne Berücksichtigung der Geschichte der Imperien, aus denen Europa hervorgegangen ist, nicht verstanden werden kann. Es ist schwierig, wenn nicht gar unmöglich, die allgemein anerkannten Nord-Süd-Vorurteile zu erklären, ohne die Zeit der spanischen Vorherrschaft in Europa und die Religionskriege im 16. und 17. Jahrhundert zu berücksichtigen. Die Dialektik zwischen Protestantismus und Katholizismus war auch eine Dialektik der Macht, die die Entwicklung der europäischen Staaten und Deutschlands in ganz besonderer Weise beeinflusste. Ich denke, dass dieser Teil für die deutschsprachige Leserschaft besonders interessant sein könnte, nicht nur im Hinblick auf die religiösen Konflikte, sondern auch auf die religiösen Vorurteile, die sie hinterlassen haben und die nicht der Vergangenheit angehören, sondern auch heute lebendig und einflussreich sind. In diesem Sinne ist es notwendig zu versuchen, etwas weiter in die Zukunft zu blicken und sich aktiv mit den Schwierigkeiten auseinanderzusetzen, die diese verinnerlichten Vorurteile dem Projekt der Europäischen Union bereitet haben und weiterhin bereiten. Wenn sie nicht überwunden werden, ist eine echte Integration von Nord- und Südeuropa als Voraussetzung für eine Konsolidierung der EU nicht möglich. Im Falle Deutschlands ist das besonders wichtig, nicht nur, weil Deutschland eine zentrale Rolle beim Aufbau der EU spielt, sondern auch, weil es ein multikonfessionelles Land ist und ein eigenes Nord-Südgefälle in sich birgt.
Auf den Zeugnissen, die den Menschen einen höheren oder niedrigeren moralischen Status ausstellen, haben diejenigen, die in Europa oder Amerika Spanisch sprechen, die schlechtesten Noten. Deshalb hat Donald Trump, als er erklärte, es sei notwendig, unerwünschte Einwanderer aus den USA zu vertreiben, das Wort »hombres« auf Spanisch verwendet: »get out the bad hombres”. Es hat den Anschein, dass das Adjektiv »bad« sich hervorragend als erläuterndes Adjektiv für das spanische Wort »hombre« eignet. Hin und wieder tun dies auch Minister aus EU-Ländern, wie zum Beispiel der niederländische sozialdemokratische Minister Jeroen Dijsselbloem, der 2017 sagte, die Länder des Südens könnten nicht erst ihr Geld für Alkohol und Frauen ausgeben und dann um Hilfe bitten. So etwas wird völlig unverhohlen von jemandem ausgesprochen, der sich scheinbar in einem Europa wohl fühlt, das eindeutig in zwei Menschengruppen eingeteilt ist: die Ehrlichen und Fleißigen im Norden und die Schurken und Faulen im Süden.
Die Verschiebung der Bedeutung des deutschen Wortes »welsch«, das ursprünglich in etwa »gallisch« und dann allgemein »Menschen, die südlich von Deutschland leben« bezeichnete, hin zu »unmoralisch«, »verlogen« oder »unanständig«, die wir in Teil II von Imperiophobie untersuchen, hat mit der Zeit der spanischen Hegemonie, mit den Religionskriegen und der antikatholischen Propaganda zu tun, die von diesen Konflikten hervorgerufen wurde.
Wie aus dem Gesagten hervorgeht, ist der Inhalt dieses Buchs keineswegs auf das Spanien des 21. Jahrhunderts beschränkt. Beginnend mit dem Römischen Reich geht es eher um die Geschichte des Abendlandes. Vielleicht hilft es, die Geschichte Europas, der ab der Zeit Karls I. viele Seiten gewidmet sind, besser zu verstehen und die vielen Vorurteile, die wir Europäer untereinander haben, zu überwinden.
--
Über das Buch
Sind Imperien per se schlecht?
Der Aufbau der europäischen Einheit scheitert nicht zuletzt an tief verwurzelten Vorurteilen unter den Europäern, vor allem unter den Nordeuropäern gegenüber denen des Südens. Maria Elvira Roca Barea geht der Frage nach, woher diese Vorurteile kommen, die auf Spaniens imperialer Geschichte und auf dem schlechten Bild des Katholizismus gründen. Roca Barea legt mit diesem Buch den Grundstein, um das Verständnis unter den Europäern zu verbessern. Denn das ist eine notwendige Voraussetzung für ein freies, demokratisches und geeintes Europa, um inmitten der kommenden Turbulenzen zu überleben.
Der Autor / Die Autorin

Maria Elvira Roca Barea
Maria Elvira Roca Barea ist Absolventin der Klassischen und Hispanischen Philologie und promovierte in klassischen Sprachen. Sie hat mittelalterliche Texte in lateinischer und romanischer Sprache…
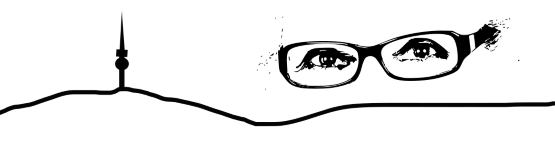





Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.