
https://peterbeinart.substack.com/p/lessons-from-afghanistan-a-year-later?utm_source=substack&utm_medium=email
Bild: Shutterstock
Lehren aus Afghanistan ein Jahr später
von Peter Beinart
15. August 2022
Kurz vor dem ersten Jahrestag des amerikanischen Rückzugs aus Afghanistan lohnt es sich, zwischen zwei Fragen zu unterscheiden. Bei der ersten geht es um die Weisheit des amerikanischen Abzugs. Ist die Regierung Biden zum richtigen Zeitpunkt und auf die richtige Weise abgezogen? Darüber lässt sich streiten. Die zweite Frage bezieht sich auf die Weisheit des Einmarsches der USA. War es richtig, dass die Bush-Regierung in Afghanistan einmarschiert ist und es besetzt hat? Die Antwort ist viel klarer: Nein. Die Entscheidung erwies sich als völliges Desaster. Nach Angaben des „Cost of War Project“ der Brown University kostete der Krieg die USA zwanzig Jahre lang rund 115 Milliarden Dollar pro Jahr. Für diesen Betrag hätten die USA laut einer Studie der Brookings Institution die Kinderarmut nahezu beseitigen können. Und die Kosten waren nicht nur finanzieller Natur. Der Afghanistankrieg kostete mehr als zweitausend Amerikanern und siebzigtausend Afghanen und Pakistanern das Leben und hinterließ Afghanistan selbst in Trümmern.
Was können wir aus dieser Katastrophe lernen? Zwei Lektionen stechen hervor. Erstens: Respektiert die Macht des Nationalismus. Zweitens: Hört auf die Stimmen außerhalb des außenpolitischen Mainstreams.
Doch zunächst ein Wort zu dem am Freitag stattfindenden Zoom-Treffen. Anfang dieses Monats lieferte sich Israel einen Schusswechsel mit einer Gruppe im Gazastreifen, dem Palästinensischen Islamischen Dschihad, den es auch im Westjordanland bekämpft. Die amerikanischen Medien konzentrieren sich manchmal auf die militanten palästinensischen Gruppen auf Kosten der normalen Palästinenser: Als ob das Einzige, was man über die Menschen in Gaza wissen muss, ist, dass vor sechzehn Jahren eine Mehrheit von ihnen für die Hamas gestimmt hat. Nichtsdestotrotz ist die palästinensische Politik wichtig. Und die jüngsten Kämpfe haben mich daran erinnert, wie wenig ich über den Palästinensischen Islamischen Dschihad weiß. Aus diesem Grund habe ich Erik Skare für diesen Freitag zu uns eingeladen. Er ist Postdoktorand am Pariser Institut für politische Studien (Sciences Po) und Autor des Buches A History of Palestinian Islamic Jihad: Faith, Awareness, and Revolution in the Middle East. Wie immer werden wir Ihre Fragen im Chat beantworten.
Zurück zu den Lehren aus Afghanistan. In einer kürzlich erschienenen Kolumne über den Krieg hat Fareed Zakaria auf zwei wesentliche Punkte hingewiesen. Erstens haben die Taliban die USA vor allem deshalb besiegt, weil sie sich die Macht des Nationalismus zunutze gemacht haben. Zakaria zitiert einen ehemaligen US-Berater in Afghanistan, Carter Malkasian, der schrieb, die Taliban „kämpften für den Islam und den Widerstand gegen die Besatzung, Werte, die in der afghanischen Identität verankert sind. Die Regierung, die sich mit den ausländischen Besatzern verbündet hat, konnte keine ähnliche Inspiration aufbringen“.
Hätten die US-Beamten dies besser verstanden, hätten sie sich viel mehr Mühe gegeben, um zu verhindern, dass der Krieg gegen Al-Qaida – eine länderübergreifende Gruppe, die von einem Saudi und einem Ägypter angeführt wird und Afghanistan als Basis nutzt – zu einem Krieg gegen die Taliban wird. Aber das haben sie nicht getan. Anstatt die Taliban als eine nationalistische Kraft zu betrachten, die sich grundlegend von Al-Qaida unterscheidet, konzentrierten sich die amerikanischen Kommentatoren auf die Gemeinsamkeiten der beiden Gruppen: Eine grotesk illiberale, ja totalitäre Form des Islamismus. Man ging davon aus, dass keine ideologisch so hässliche Bewegung einen erfolgreichen Aufstand gegen die USA führen könnte.
Doch diese Annahme war ein Fehler. Es war ein Irrtum, denn Nationalismus muss nicht liberal oder human sein, um glühendes Engagement zu wecken. Angesichts der historischen Macht des illiberalen Nationalismus in unserem eigenen Land – Millionen von Amerikanern, die sich Figuren wie Andrew Jackson, Joe McCarthy, George Wallace und Donald Trump verschrieben haben – hätten die amerikanischen Behörden dies besser verstehen müssen. Aber das haben sie nicht. Stattdessen haben sich die amerikanischen Politiker seit dem Zweiten Weltkrieg immer wieder ideologische Prismen zu eigen gemacht, die sie für die Macht des Nationalismus im Ausland blind machen, während sie ihn im Inland kanalisieren. Weil die Regierungen Kennedy und Johnson vom Kampf gegen den Kommunismus besessen waren, konnten sie nicht erkennen, dass viele einfache Vietnamesen Ho Chi Minh als Nationalisten betrachteten, der einen antikolonialen Kampf führte, der gegen die Franzosen begonnen hatte. Weil sich die Beamten der Bush-Regierung auf Saddam Husseins Brutalität gegenüber seinem eigenen Volk konzentrierten, konnten sie sich nicht vorstellen, dass selbst Iraker, die Saddam verabscheuten – wie etwa Muqtada al-Sadr, der schiitische Geistliche, dessen Vater, Schwiegervater und Geschwister Saddam ermordet hatte -, dennoch gegen die amerikanischen Invasoren kämpfen würden, die ihn stürzten, weil sie nicht wollten, dass ihr Land von einer ausländischen Macht kontrolliert wird. Weil die Falken in Washington heute den Iran als die Wurzel der antiamerikanischen und antiisraelischen Militanz sehen, übersehen sie die Tatsache, dass die Bewegungen, die der Iran unterstützt – von den Houthis über die Hisbollah bis zur Hamas – ihre wahre Unterstützung aus nationalistischen und sektiererischen Missständen vor Ort beziehen. Der Iran kontrolliert die militanten Gruppen im Jemen, Libanon und Gaza genauso wenig wie China und die Sowjetunion Nordvietnam.
Ich will damit nicht sagen, dass sich die USA niemals gegen Armeen wehren sollten, die von Nationalismus angetrieben werden. Wenn der giftige Nationalismus eines Landes seine Grenzen sprengt und zu einem Imperialismus wird, der sich gegen seine Nachbarn richtet, kann er eine echte Bedrohung darstellen. In solchen Fällen – man denke nur an den Einmarsch Nazi-Deutschlands in Frankreich oder den aktuellen Einmarsch Russlands in der Ukraine – werden die USA motivierte Verbündete in den angegriffenen Ländern finden. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, zwischen dem Kampf gegen den ausländischen Imperialismus und dem Kampf gegen nationalistische Bewegungen zu unterscheiden, die, so verabscheuungswürdig sie auch sein mögen, in ihrem eigenen Land agieren.
Diese Unterscheidung wird sich im wachsenden Kalten Krieg mit China als entscheidend erweisen. In dem sich abzeichnenden globalen Schachspiel werden die amerikanischen Falken wahrscheinlich überall die Hand Pekings sehen. Man kann sich leicht ein Szenario vorstellen, in dem ein pro-chinesischer Führer die Macht übernimmt – sei es auf den Salomonen oder in einem anderen Land Amerikas – und die Falken in Washington den Einsatz der CIA oder der Marines fordern, um sicherzustellen, dass das Land nicht zu einer chinesischen Garnison wird. Die Lehre aus Afghanistan und den vielen Missgeschicken der USA im Kalten Krieg ist, dass diese Art von Intervention selten gut ausgeht. Die USA müssen in den kommenden Jahren darauf achten, dass unsere zunehmend chinesisch geprägte Weltsicht nicht zu Konflikten mit Bewegungen führt, die wir als Handlanger Pekings betrachten, die aber ihre wahre Stärke aus dem nationalistischen Wunsch beziehen, nicht von den USA schikaniert zu werden.
Die zweite Lehre aus Afghanistan ist, dass Menschen außerhalb des außenpolitischen Mainstreams manchmal Recht haben. Zakaria erinnert uns daran, dass nicht nur rechte Politiker den Krieg in Afghanistan unterstützt haben. Der Krieg war besonders bei den Demokraten beliebt. Im Juli 2008 hielt der Präsidentschaftskandidat Barack Obama eine Rede, in der er einen „Zeitplan für den Abzug der US-Streitkräfte“ aus dem Irak forderte und gleichzeitig „mindestens zwei zusätzliche Kampfbrigaden für Afghanistan“ versprach. Im Nachhinein erscheint das verrückt: Beide Kriege waren nicht zu gewinnen. Aber damals gehörte man als Gegner beider Kriege zu den Chomsky-Anhängern, den Verrückten am Rande. Gerade Obamas ablehnende Haltung gegenüber dem Irak machte es erforderlich, dass er – der konventionellen politischen Logik folgend – in Bezug auf Afghanistan die Falken spielen musste, um nicht als ein weiterer George McGovern abgestempelt zu werden.
Die amerikanischen Medien neigen zu der Annahme, dass, wenn sich Politiker beider Parteien über etwas einig sind – wie den Afghanistankrieg -, die Abweichler Verrückte sein müssen. Aber die Verrückten haben manchmal Recht. In bestimmten Momenten ist die Bandbreite der politisch akzeptablen Optionen zu gering, um eine Politik zu verfolgen, die sich als richtig erweist. Als das Repräsentantenhaus und der Senat 1964 für die Tonkin-Resolution stimmten, die Lyndon Johnson ermächtigte, Truppen nach Vietnam zu entsenden – eine der katastrophalsten außenpolitischen Abstimmungen in der Geschichte der USA -, stimmten nur zwei Mitglieder des Kongresses mit Nein. Noch 1968 war selbst Eugene McCarthy, der als Antikriegskandidat für das Präsidentenamt kandidierte, nicht für einen vollständigen und einseitigen Rückzug aus Vietnam. Es dauerte weitere sieben Jahre – und unzählige amerikanische und vietnamesische Tote -, bis der Kongress genau dies forderte.
Die Lektion für die Amerikaner von heute ist nicht, dass das überparteiliche außenpolitische Establishment, das im Allgemeinen in eine hawkistische Richtung tendiert, immer falsch liegt. Vielmehr sollten die Medien denjenigen, die aus der Reihe tanzen, mehr Sendezeit einräumen und mehr Spalten füllen. Wenn Menschen außerhalb des ideologischen Mainstreams stehen, vor allem in Kriegszeiten, ist es leicht, sie als Verräter oder Spinner zu verhöhnen, anstatt auf ihre Ideen einzugehen. Seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine haben die Falken beispielsweise immer wieder Menschen, die der NATO-Erweiterung skeptisch gegenüberstehen, als Putin-freundliche Dummköpfe bezeichnet. In Washington wird es heute immer schwieriger, für eine Zusammenarbeit und Kompromisse mit China einzutreten, ohne als Apologet Pekings abgestempelt zu werden. In Anbetracht der Tatsache, dass diese Verleumdungen in der Vergangenheit häufig gegen Personen eingesetzt wurden, deren abweichende Meinung zu Vietnam, Afghanistan und Irak sich als vorausschauend erwies, sollten die Vertreter des außenpolitischen Establishments mehr Demut an den Tag legen. Die Lehre aus Afghanistan ist, dass die Bandbreite der Ansichten, die moralisch und strategisch richtig sein können, zu jedem Zeitpunkt viel größer ist als die Bandbreite der Ansichten, die in Washington als ideologisch respektabel gelten. In der Außenpolitik lohnt es sich, auf Leute zu hören, die weithin als verrückt abgetan werden. Manchmal haben sie Recht. Übersetzt mit Deepl.com
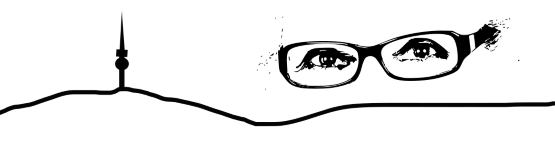





Die Afghanen sind keine Nationalisten. Die Stämme bekämpften sich schon zu Engels Zeiten. “ `Ihr unbezwinglicher Hass auf jede Herrschaft und ihre Vorliebe für persönliche Unabhängigkeit verhindern, dass sie eine mächtige Nation werden.´ Das schrieb Friedrich Engels 1857 über die Afghanen. Seine Beobachtungen sind noch heute aktuell.“ (Welt) Der Islam hat in Afghanistan gesiegt. In den Staaten des Nahen Ostens und Nordafrikas hat der Islam Funktionen die seine politische Bedeutung erklären. Im Vordergrund steht der Schutz der Familie, der für Gesellschaften ohne modernes Sozialsystem essentiell ist. Diese Staaten sind zu arm, um die Kosten für den Zerfall der Familie zu übernehmen. ( In diesem Zusammenhang möchte ich allerdings darauf hinweisen, dass inzwischen „moderne“ Staaten die Lasten einer Scheidung dem besser gestellten Expartner übertragen.) Und wenn es auch keine funktionierende Justiz gibt, ist religiöse Rechtssprechung möglicherweise die beste Alternative. Nicht zuletzt ist der Islam als einheitsstiftende Institution in der Lage, den Tribalismus einzuschränken. Mit democrazy (kein Schreibfehler), nämlich repräsentative Herrschaft für das Volk statt direkte Herrschaft durch das Volk, die Korruption und Tribalismus fördert, und freedom = Entwurzelung, wurde den Afghanen kein brauchbares Gesellschaftsmodell angeboten. Vielmehr wirkten Größenwahn und Arroganz des Westens abschreckend.